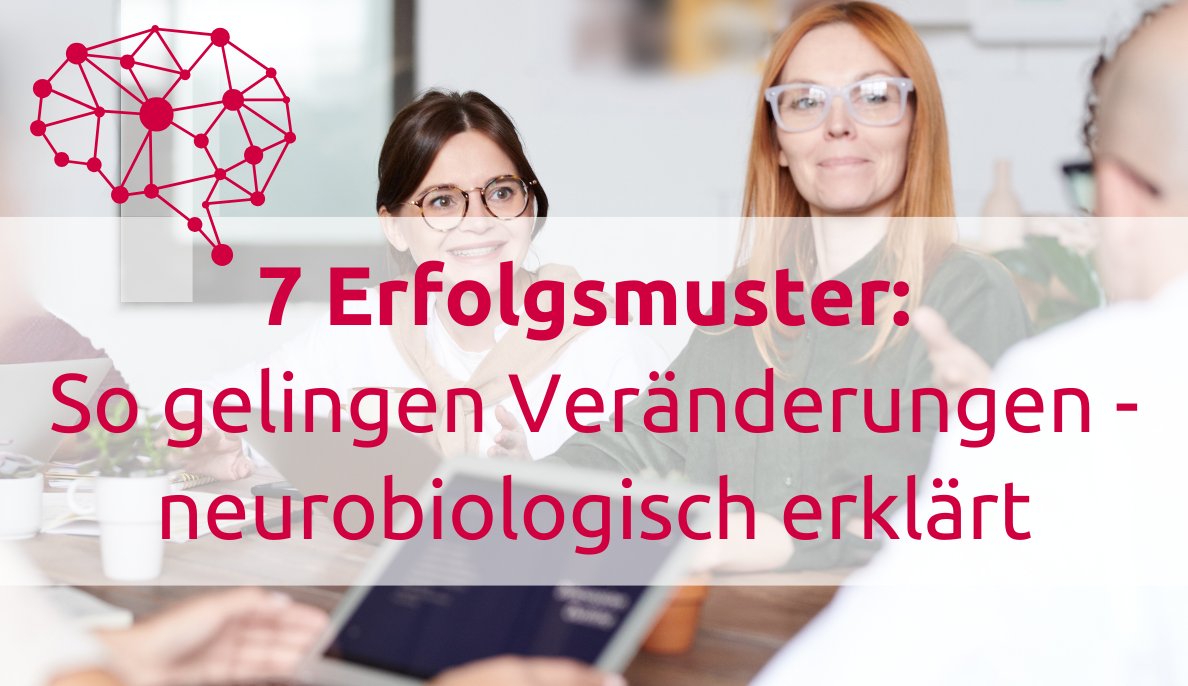Warum scheitern so viele Veränderungsprozesse? Wieso erleben Mitarbeitende Wandel oft als Bedrohung – obwohl doch alle wissen, dass Anpassung überlebenswichtig ist?
Die meisten Change-Prozesse verpassen nicht, weil die Strategie schlecht ist. Sondern weil die betroffenen Menschen sie innerlich blockieren.
Die gute Nachricht lautet:
Es gibt Muster, die Veränderung nicht nur möglich machen, sondern sie auch zu einem nachhaltigen Erfolg führen.
Das Faszinierende daran: Diese Muster lassen sich neurobiologisch erklären und in der Praxis belegen.
Das Gehirn im Wandel – warum Bedrohung uns blockiert
Veränderung ist für unser Gehirn zunächst ein Risiko. Sobald Mitarbeitende den Wandel als Bedrohung wahrnehmen, schlägt die Amygdala – der „Gefahrenradar“ – Alarm.
Kreativität, Empathie und vorausschauendes Denken gehen zurück, weil der präfrontale Cortex, unser Zentrum für kluge Entscheidungen und innovative Ideen, blockiert ist.
Genau die Fähigkeiten, die Unternehmen im Wandel dringend brauchen, sind dann nicht abrufbar.
Doch es gibt einen Weg heraus aus dieser Blockade:
Zugehörigkeit und Vertrauen fördern die Ausschüttung von Oxytocin, einem Neurotransmitter, der die Amygdala beruhigt und den Zugriff auf das volle mentale Potenzial wiederherstellt.
Die Neurowissenschaft zeigt: Nachhaltige Veränderung gelingt vor allem dann, wenn die Grundbedürfnisse nach Sicherheit, Mitbestimmung und Sinn erfüllt werden.
Die 7 Erfolgsmuster für gelingende Veränderung
1. Verbundenheit
Sich verbunden zu fühlen ist eines unserer ganz grundlegenden menschlichen Bedürfnisse: Ein Primärbedürfnis!
Zugehörigkeit und das Gefühl der Verbundenheit sind ein neurobiologischer Türöffner: Sie beruhigen das Stresssystem, reduzieren Angst und ermöglichen Engagement.
Fühlen sich Menschen verbunden und zugehörig, wird im Gehirn vermehrt der Botenstoff Oxytocin ausgeschüttet. Das bewirkt das Gefühl, innerlich verbunden zu sein. Wenn dieses Gefühl verloren geht, werden die Schmerzzentren im Gehirn aktiviert. Damit gehen Mitarbeitende in die neuronale Überregung – das ist der „Worst-Case-Betriebszustand“.
Der Idealzustand unseres Gehirns sieht dagegen so aus: Neuroplastische Botenstoffe ergießen sich im präfrontalen Cortex und neue neuronale Netzwerke entstehen. Dadurch können Menschen Neues lernen und auf neue Ideen kommen. Im präfrontalen Cortex finden außerdem Kreativität, Empathie, vorausschauende Handlungsplanung, Impulskontrolle und viele weitere geistige Leistungen statt. Das ist auch der Idealzustand, den Ihre Mitarbeiter möglichst häufig einhalten sollten.
2. Das "Warum?" klären
Warum sollten Sie den Wandel Ihrer Mitarbeitenden auf den Sinn ausrichten?
Weil Menschen wissen wollen, wozu etwas gut ist.
Das gelingt über Verstehbarkeit und eine fortlaufende interne Kommunikation der angestrebten Veränderung.
Klären Sie dabei diese Fragen: „Warum ist es wichtig, dass wir etwas ändern – und was passiert, wenn alles so bleibt, wie es ist?“
Findet diese Ausrichtung auf das „Warum“ nicht statt und werden Menschen im Unklaren gehalten, geschieht etwas, das Jeanie Duck, eine Pionierin des Change Managements, so beschreibt: „Menschen verbinden die wenigen Informationen, die sie haben, auf höchst pathologische Art und Weise.“ Dann entstehen abenteuerliche Erzählungen über die beabsichtigten Veränderungen.
Wenn das geschieht, wird außerdem die Amygdala (der „Gefahrenriecher“ unseres Gehirns) aktiviert: Mitarbeitende verlieren den Zugriff auf ihre Potenziale.
Der Hirnforscher Gerald Hüther nennt das den „Feuerwehrschlauch Modus“. Damit verfallen Menschen in alten, in der frühen Kindheit erlernten Verhaltensweisen - oder , noch schlimmer, in einem Angriffs-, Flucht-, oder Starre-Modus. Damit ist jegliche Zusammenarbeit blockiert.
Wenn Menschen jedoch wissen, wofür sich die Mühe lohnt, bleiben sie viel eher motiviert und sind bereit, den Weg mitzugehen.
Deshalb sollte Ihr Unternehmen jede Veränderung klar kommunizieren und das „Warum“ gut verständlich machen. Das setzt innere Energie bei Ihren Mitarbeitenden frei.
3. Mitgestaltung
Was passiert, wenn Mitarbeitende selbst gestalten dürfen?
Das Gefühl von Autonomie aktiviert das Belohnungssystem im Gehirn – Dopamin fließt, Motivation steigt.
Menschen erleben Selbstwirksamkeit und übernehmen Verantwortung. Veränderung wird nicht länger „von oben verordnet“, sondern von innen herausgetragen.
Dürfen Menschen Veränderungen mitgestalten, bleiben sie länger gesund. Und sie behalten den Zugriff auf die in ihnen liegenden Potenziale und höheren geistigen Leistungen.
Das hat die englische Langzeitstudie Whitehall II eindrücklich belegt. In dieser bekannten Umfrage wurden mehr als 10.000 Angestellte untersucht. Eine der zentralen Erkenntnisse: War die Möglichkeit der Mitgestaltung niedrig, stieg die Wahrscheinlichkeit einer Herzerkrankung um 30 Prozent!
4. Feedback-Kultur
Wie schnell entstehen Vorbehalte, weil der andere sich gerade „komisch“ verhält? Wie schnell entsteht aus kleinen Vorbehalten allgemeine Abneigung?
Situative und konstruktive Feedback-Kultur ist ungeheuer hilfreich: Kleine Missverständnisse können ausgesprochen und bereinigt werden, bevor sich großer Ärger anstaut.
Denn negative Gefühle belasten unsere Arbeitsbeziehungen und verhindern, dass Menschen sich gegenseitig helfen.
Feedback geben und nehmen zu können, macht einen erheblichen Unterschied: Mitarbeitende sind nachweisbar zufriedener, wenn konstruktives Feedback gelingt.
Da nicht jeder Mensch von sich aus dazu in der Lage ist, konstruktives Feedback zu geben – und mit erhaltenem Feedback gut umzugehen – kann es sinnvoll sein, über Feedback-Regeln nachzudenken und diese gemeinsam zu trainieren.
5. Fehlertoleranz
Warum lähmen Fehlerangst und Schuldzuweisungen jede Transformation?
Weil sie Menschen in den Abwehrmodus schicken.
Wer Fehler jedoch als Lernchance begreift, öffnet den Raum für Innovation. Eine offene Fehlerkultur sorgt dafür, dass Ideen entstehen, anstatt im Keim erstickt zu werden.
6. Führung als Vorbild
Wie glaubwürdig ist ein Wandel, wenn die Führungsetage selbst nicht mitzieht?
Menschen folgen nicht den Worten, sondern viel mehr dem Verhalten ihrer Vorgesetzten. Das ist ein im menschlichen Gehirn angelegter Reflex: Wir suchen uns Beispiele oder Vorbilder, an denen wir uns orientieren und unser eigenes Verhalten gleichsam „einsortieren“.
Veränderung gelingt nur dann, wenn Führungskräfte sie sichtbar vorleben – anstatt das Gegenteil dessen zu tun, was sie selbst predigen.
Dabei sollten Führungskräfte Ihre Mitarbeitenden zur aktiven Mitarbeit einladen. Das gelingt umso besser, je besser das innere Bild ist, dass Führungskräfte von Ihren Teammitgliedern haben. Denn nur wer an seine Leute glaubte, wird ihnen auch etwas zutrauen.
Hilfreiche Frage, die Führungskräfte ihren Mitarbeitenden stellen können, lauten zB: „Wo seht ihr bei mir als Führungskraft das größte Entwicklungspotenzial?“
Oder: „Was braucht ihr von mir, damit ihr als Team besser zusammen arbeiten könnte?“
Was sollte „ganz oben“ passieren?
Der obersten Entscheidungsebene, dem C-Level, kommt die Aufgabe zu, die erforderlichen Ressourcen (Zeit, Geld., Personal) zur Verfügung zu stellen. Und andererseits den Wandel zu legitimieren und seine Sinnhaftigkeit fortlaufend zu kommunizieren.
7. Achtsamkeit: Emotionen zulassen und regulieren
Welche Rolle spielen Emotionen im Wandel?
Sie sind entscheidend. Werden sie ignoriert, entstehen Blockaden; Werden sie bewusst, kann daraus Energie für Neues wachsen.
Achtsame Führung, regelmäßige Gespräche und ein konstruktiver Umgang mit Gefühlen schaffen eine emotionale Basis für Veränderung.
Dafür brauchen Führungskräfte Methoden, um ihren eigenen Stress zu bewältigen und sich selbst innerlich gut zu stabilisieren. Denn nur so können sie sich ihrerseits sicher fühlen und den angestrebten Wandel nicht nur verstehen, sondern auch innerlich unterstützen.
Unternehmenspraxis: Otto Group und Weleda
Otto Group: Kulturwandel 4.0 – Überleben durch radikale Transformation
2015 stand die Otto Group mit dem Rücken zur Wand. Das traditionelle Versandgeschäft war im Niedergang, Amazon und Zalando dominierten den Markt. Die Antwort hieß „Kulturwandel 4.0“ – ein Programm, das nicht nur Strukturen, sondern vor allem Haltungen verändern sollte.
Damals stellt sich Benjamin Otto vor seine versammelte Belegschaft und sagt sinngemäß: Liebe Leute, wir kriegen das alleine nicht hin. Wir sind auf eure Mitarbeit angewiesen. Wir wünschen uns, dass ihr mitgestaltet: Bitte bringt eure besten Ideen ein. Nur so können wir das schaffen!
Otto Birken (CEO) nannte es so: Wir haben die Hierarchie-Pyramide auf den Kopf gestellt.
Herausgekommen ist zB „Otto Now“, ein Mietmodell, mit dem Kunden eine Waschmaschine mieten können oder eine Drohne, einen Fernseher. Dieses Sharing-Modell war eine Idee aus der Mitte der Belegschaft.
So entwickelte sich Otto zu einem modernen E-Commerce-Konzern, gewann an Innovationskraft und wurde wieder attraktiv für Talente. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie Vertrauen, Sinn und Mitgestaltung eine ganze Organisation neu ausrichten können.
Weleda: Vertrauen in die Potenziale der Jüngsten
Auch Weleda zeigt, was Vertrauen wirken kann.
Das Unternehmen gründete eine Juniorfirma, in deren Ausbildenden die Möglichkeit erhalten wurde, ein eigenes Produkt von der Idee bis zur Umsetzung zu entwickeln. Verantwortung, die in vielen Unternehmen undenkbar wäre, wurde hier Realität.
Das Ergebnis war verblüffend:
Die Jugendlichen entwickelten überdurchschnittlich kreative Leistungen und erlebten eine enorme Selbstwirksamkeit. Für das Unternehmen war dies mehr als ein Lernprojekt – es war ein Signal: Wir vertrauen euch, wir trauen euch zu, Zukunft zu gestalten.
Genau dieses Vertrauen setzt Potenziale frei, die weit über den Rahmen der Juniorfirma hinauswirken.
Fazit: Veränderung gelingt, wenn Mensch und Hirn im Mittelpunkt stehen
Die sieben Erfolgsmuster nach Gerald Hüther und Sebastian Purps-Pardigol zeigen klar: Veränderung scheitert nicht an Strategien, sondern daran, dass menschliche Grundbedürfnisse nicht berücksichtigt werden.
Sie wollen Veränderungen wirksam umsetzen – und fragen sich, wie Sie Ihre Teams für die anstehende Transformation ins Boot holen können?
Lassen Sie uns sprechen. Ich zeige Ihnen, wie Sie mit wissenschaftlich fundierten Methoden und praxiserprobten Ansätzen Veränderung so gestalten, dass sie wirklich gelingt.
Schreiben Sie mir eine Nachricht oder rufen Sie mich an: Gemeinsam finden wir heraus, wie Sie die sieben Erfolgsmuster für Ihr Unternehmen nutzen können.